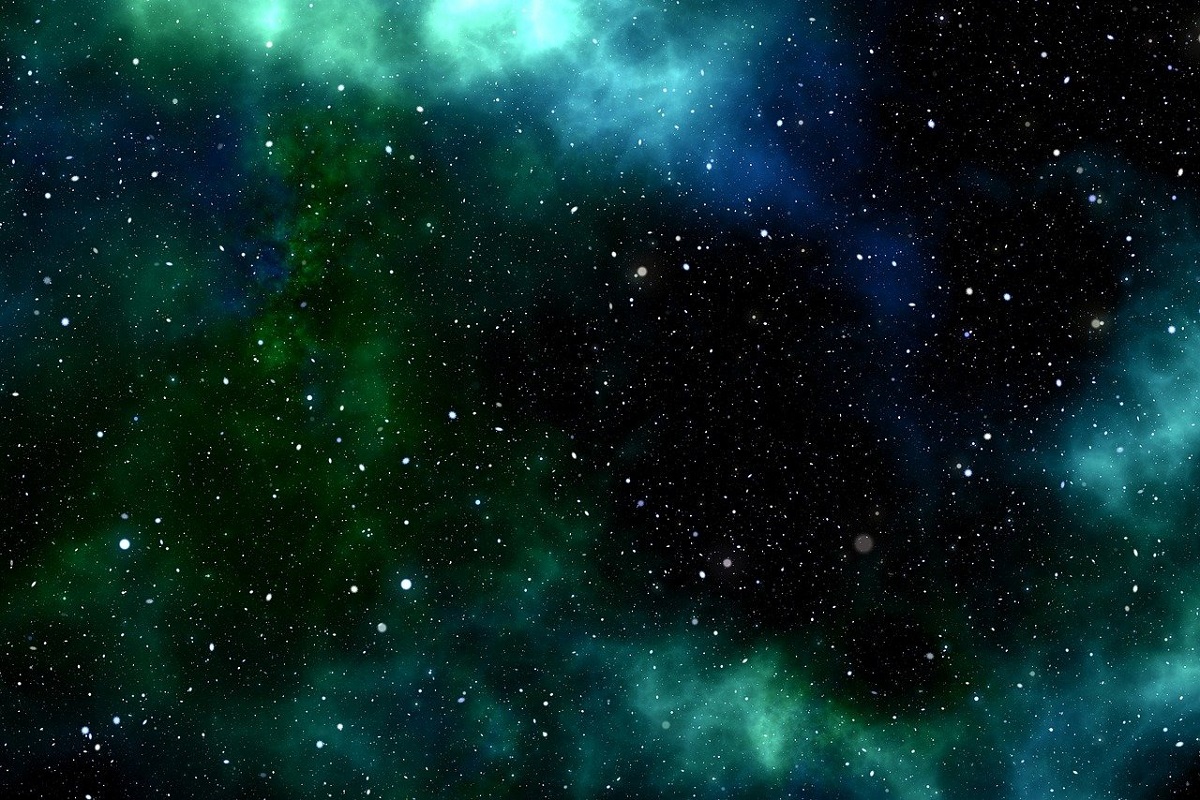Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ich in meinen Texten häufig gendere, und zwar wild gemischt – mal mit Doppelpunkt, mal, indem ich die Chefin und den Kollegen nebeneinander stelle, oder absatzweise von der weiblichen zur männlichen Form (= zum generischen Maskulinum) wechsele. Ich versuche – nicht dogmatisch, sondern spielerisch – das weibliche Prinzip in meine Texte einzuladen und ich finde wichtig, dass es vorkommt, denn Sprache ist mächtig. Sprache formt unser Denken und unser Denken formt die Welt, die wir wahrnehmen, unsere ganz persönliche Realität. Und wenn diese hausgemachte Realität voller generischer Maskuline ist, dann ist es eine Gedankenwelt voller Männer. Wenn jemand sagt „ich gehe zum Arzt“, dann sehe zumindest ich gedanklich einen Mann im weißen Kittel, keine Frau. Wie geht es dir?
Gespräche über starke(?) Frauen
Kann es sein, dass unser deutsches generisches Maskulinum die Frau eben nicht „automatisch“ mit meint? Diese fragende Haltung habe ich nicht immer gehabt. Als das Gendern begann, gehörte ich zur Spott-Fraktion mit dem Tenor „Echt jetzt, haben wir keine größeren Probleme?“. Doch nun ist es ja so, dass ich mein Geld mit Sprache verdiene und mich natürlich auch mit meinen Autor:innen oder Schreibcoachees darüber auseinandersetzen darf, wie und ob in ihren Büchern oder Texten gegendert wird. Und irgendwann wurde ich hellhörig, spätestens, als ich mein Projekt „Gespräche über starke(?) Frauen“ begann.
Ich fühlte eine große Ungleichheit, einen leeren Raum in der deutschen Sprache, in dem Frau nicht vorkommt. Und ich glaube mittlerweile, dass die ermüdende Gendersternchen-Diskussion symptomatisch ist für all die emanzipationsbewegten Jahrzehnte, die hinter uns liegen. Wenn wir von außen darauf schauen, dann haben „starke“ Frauen ganz viel erreicht. Seit Frauen öffentlich mitmischen, konnten sie viel dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft offener geworden ist. Politikerinnen haben sich dafür eingesetzt, dass die Gleichheit im Gesetz verankert wird, haben sich für Mutterschutz, Kindeswohl, für Alleinerziehende, für Geschiedene engagiert. In vielen Unternehmen wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Thema gemacht. Im Rückblick auf die Geschichte ist erkennbar, dass die Positionen der Frauen sich in vielen Teilen der Welt positiv gewandelt haben. Im globalen Norden offensichtlich, aber auch in anderen Teilen der Welt verzeichnen wir zum Beispiel einen Anstieg von Bildungsgleichheit, so hat sich die weltweite Einschulungsrate von Mädchen im Grundschulalter der von Jungen immer weiter angepasst.[1] (Was nichts darüber aussagt, wie lange und ob überhaupt diese Mädchen zur Schule gehen werden.) Das alles Wichtige annähernd erreicht wurde, scheint vielen Betrachtern und Betrachterinnen genau dadurch belegt zu sein, dass wir jetzt über Gendersternchen oder geschlechtsneutrale Toiletten diskutieren. Wenn das die einzigen Themen sind, die bis zur Gleichstellung noch übrig bleiben und alles andere bereits geschafft ist, dann müssten wir zutiefst und von Herzen dankbar sein. Oder? Frauen können scheinbar alles – auf den Mond fliegen, Vorständin werden oder Kanzlerin – sie können entscheiden, wo sie mit wem auf welche Art leben möchten. Sie sind gut ausgebildet – besser als die Männer[2] – und dürfen zusätzlich auf Sonderbehandlungen, wie zum Beispiel einen „Girls Day“ zugreifen, der ihnen die Möglichkeit schmackhaft machen soll, im typisch männlichen MINT-Umfeld Karriere zu machen. Das Glas ist aus dieser Perspektive voll oder mindestens halbvoll.
#tradwife
Wenn das so ist – warum fühlt es sich dann immer noch halbleer an? Warum nehmen wir die Realität so anders wahr? Warum sind es auch ganz junge Frauen, die die Präsentation in akribischen Überstunden vorbereiten, die der Kollege dann halten darf? Warum sind durch die Corona-Maßnahmen so viele Frauen (freiwillig?) wieder an den heimischen Herd zurückgekehrt und gefallen sich jetzt in der Rolle des #tradwife? Warum brauchen wir die Quote, obwohl es statistisch deutlich mehr gut ausgebildete Frauen als Männer gibt – wo sind die alle? Wollen die nicht in die Führungspositionen und wenn sie nicht wollen – warum nicht? Wollen Frauen vielleicht gar nicht gleichgestellt sein?
Warum sind Männer die Norm? Nicht nur in der Sprache, sondern auch in medizinischen Studien, bei Crashtests, bei der Raumtemperatur in Großraumbüros … obwohl die Welt doch zu immerhin 50 Prozent weiblich ist? Kann es sein, dass unsere Welt nach wie vor die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, weil sie weiterhin von Männern und für Männer gemacht wird, wie es Caroline Criado-Perez in ihrem Wälzer „Unsichtbare Frauen“ darstellt?[3] In einer von Big Data beherrschten Welt kämen Frauen nicht vor, schreibt sie, weil die erhobenen Daten sich fast ausschließlich auf die „Norm“, den mittelalten, 70 Kilo schweren, weißen Supermann beziehen würden, der die gesamte Welt repräsentiert.[4] Folgen wir dieser Darstellung, dann befinden sich Frauen nach wie vor in einer Wahrnehmungslücke. Und so entsteht die Frage, ob Gendersternchen diese Wahrnehmungslücke füllen können. Ganz ehrlich? Ich glaube, sie können es nicht. Aber sie können uns aufwecken, uns einladen hinzuschauen. Sie sind Stolpersteine in Texten und jedes Mal, wenn wir uns unangenehm daran stoßen, könnten wir mal wieder jemandem die Frage stellen: Sind Frauen sichtbar? Sichtbar genug?
Übrigens weiß ich, dass diese Stolpersteine in meinen Texten gerade für neurodiverse Menschen fast körperlich unangenehm sein können, und entschuldige mich im Voraus und Nachhinein für diese Zumutung. Doch ich halte sie für wichtig. Nicht, um „korrekt“ zu schreiben, nicht, um alle 127 Geschlechter mitzumeinen, sondern um einen Wahrnehmungsraum zu öffnen, einen Raum, in dem mich zum Beispiel Leser:innen meines Newsletters anschreiben und fragen: „Andrea, warum gendest du, warum vergewaltigst du die deutsche Sprache?“ Und dann kann ich auf diesen Text verweisen. Und kann noch ergänzen, für die, die es lesen wollen:
Perspektivwechsel
Könnte es sein, dass sich seit dem epochalen Werk von Simone de Beauvoir „Das andere Geschlecht“ nicht viel geändert hat? Der Mann ist die Norm, die Frau ist „das Andere“. Laut Beauvoir können wir die Dualität Frau/Mann nicht wie zwei elektrische Pole setzen, weil der Mann zugleich das Positive und das Neutrale vertritt. „Mann“ steht zugleich stellvertretend für die gesamte Menschheit – im Französischen bezeichnet „les hommes“ sowohl Männer als auch Menschen. (Im Englischen „man/mankind“ und wahrscheinlich noch in vielen anderen Sprachen.) Die Frau benötigt also immer die zusätzliche Bestimmung, Definition, sie muss die „starke Frau“ sein, während der Mann die Stärke ist. Der Mann ist im Recht, weil er ein Mann ist, schreibt Beauvoir, wogegen die Frau im Unrecht ist.[5] Der Mann ist das Subjekt, die Frau Objekt, der Mann repräsentiert die Wirklichkeit, die Frau … – nun, eben „das Andere“. Das erklärt, warum für so viele Männer ihre Perspektive einfach nur wie „gesunder Menschenverstand“ wirken muss. Wenn wir uns ein bisschen in die Sozio- und Neuropsychologie vertiefen, dann verstehen wir, dass Menschen im Allgemeinen dazu neigen, ihre eigene Denk- und Vorgehensweise als typisch anzunehmen. Sie neigen zudem dazu, nur das zu sehen, was ihre Wirklichkeit bestätigt, „Confirmation-Bias“ nennt das die Psychologie. So leben Männer in einer von Männern gemachten Welt und damit in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, in einer Kultur, die die scheinbare Richtigkeit ihrer Erfahrungswelt bestätigt, indem sie sie ihnen permanent zurückspiegelt. Ähnlich wie beim generischen Maskulinum wird die uneingeschränkte Akzeptanz der männlichen Perspektive als Geschlechtsneutralität wahrgenommen.
Wenn Männer die Wahrnehmung und die Sprache prägen – die Gesetze machen, die Unternehmen leiten, in den Medien[6], den Talkrunden, das Wort führen – dann prägen sie ganz selbstverständlich den Wahrnehmungsraum durch ihre, die männliche, Perspektive. Aber dieser „gesunde Menschenverstand“ auf den „man“ sich berufen mag, sei aus dieser Erklärung heraus letztlich nur das Produkt einer Projektion, einer Wahrnehmungsverschiebung und nicht zuletzt einer eklatanten Datenlücke, erklärt Criado-Perez.[7] Machen wir uns diesen Erklärungsansatz zu eigen, der auch vielfach die Grundlage feministischer Literatur ist, dann bekommen die von den meisten Frauen (und Männern) positiv bewerteten Gleichstellungsbemühungen plötzlich einen ganz anderen Touch: Das Prinzip „Frau“ wäre falsch und müsste daher irgendwie richtig gemacht werden, damit es ins Prinzip Mann, das die Welt bestimmt, passt. Anders gesagt – um gleich gestellt zu sein, müssten Frauen sich dem vorherrschenden Prinzip angleichen. In einer Welt, in der das Mannsein universell, das Frausein Abweichung wäre, könnte es ja gar nicht anders funktionieren! Wenn Frauen sichtbarer sein wollen, Teilhabe wollen, gleichberechtigt sein wollen – dann müssen sie eben mehr wie Männer sein. Und sich dementsprechend im generischen Maskulinum völlig repräsentiert und zuhause fühlen.
Eine Art Fazit
Mit diesen Gedanken will ich auf gar keinen Fall eine Diskussion über „richtig“ und „falsch“ anzetteln – weder will ich behaupten, dass Gendern richtig sei und Gleichstellung falsch. Und schon gar nicht will ich verkünden, ich wüsste, wie frau es „besser“ machen könnte. Vielleicht sind meine Gendersternchen oder Stolper-Doppelpunkte nicht viel mehr als der hilflose Versuch darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Lücke gibt. Eine Lücke, die wir nur füllen können, wenn wir das weibliche Prinzip in die Welt einladen. Und mit der Sprache könnten wir anfangen.
Da dies ein fast wissenschaftlicher Text geworden ist, gibt es auch ein paar Quellenhinweise:
[1] http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
[2] https://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplusartikel.html?artid=867
[3] Criado-Perez, Caroline. Unsichtbare Frauen. Btb-Verlag (Random House), 2020, Klappentext
[4] Ebenda, Seite 164
[5] Beauvoir, Simone de; Das andere Geschlecht; Rowohlt Taschenbuch Verlag, Neuausgabe 2000, S. 12 ff
[6] Im Gespräch über starke Frauen erklärt Mareike Graepel, das laut Studien Männer deutlich häufiger in den Medien präsent sind.
[7] Criado-Perez, Caroline. Unsichtbare Frauen. S.358